Sollte am Ende der letzten Legislatur, noch unter Bürgermeister Nekolla, die Innenentwicklung forciert werden, so gibt der neue Flächennutzungsplan, mit den Nebengeräuschen, allen voran den Rufen nach Wachstum, wieder eine andere Richtung vor: Wachstum am Stadtrand statt „Innen vor Außen“. In einer vierstündigen Sitzung redete vor allem Matthias Striebich dagegen an, fand aber kaum Gehör. Denn, so die Stadtratsmehrheit, man habe keine Instrumente.
Bauanträge
Im Zuge der FNP-Sitzung wurden auch mehrere Einzelvorhaben diskutiert. Darunter ein Grundstück am Michelsberg. Das Grundstück liegt zwischen einem geschützten Heckenbiotop (ehem. Steinbruch) und einer Streuobstwiese – ebenfalls Biotop. Dazwischen geplant: ein Einfamilienhaus mit Zufahrt. Werner Wolf sah das Biotop bereits im Ist-Zustand als geschädigt an, Matthias Striebich warnte vor fehlenden Abstandsflächen und der Beeinträchtigung dieses Biotops. Trotzdem stimmte der Stadtrat mit 10:3 für das Vorhaben. Erst jetzt wird um eine Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde angefragt, diese dürfte entscheidend sein.
Ein Bauvorhaben für zwei Häuser am Ortsrand von Haidhof wurde einstimmig (12:0) befürwortet. Das Projekt war zuvor mehrfach öffentlich und nicht-öffentlich beraten worden. Ein Vorhaben in Lilling an der Straße nach Dorfhaus wurde abgelehnt. Der Antrag enthielt zu viele Unklarheiten, zu viele Konjunktive. Es wurde empfohlen, abzuwarten, bis konkreteres Interesse an einer Bebauung vorliegt.
Ein bereits bekanntes Solarparkprojekt verteilt sich auf drei Flächen (Katzenstein, zwischen Steinbruch Endress und Sollenberg, sowie Richtung Lillinger Höhe). Der Stadtrat stimmte mit drei Gegenstimmen aus der CSU für die Aufnahme eines weiteren Grundstücks am Katzenstein.
Lehrstück „Persönliche Beteiligung“
Bevor der Flächennutzungsplan diskutiert wurde, traten Bürgermeister und die Verwaltung erst einmal ihren Gang nach Canossa an. Hintergrund: Im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes war über Grundstücke der Brüder Kunzmann (Bürgermeister Ralf und Stadtrat Gernot) eine Frischluftschneise geplant worden. Beide gaben daraufhin Stellungnahmen ab, forderten deren Verlegung und reklamierten „großen Widerstand“ – verbunden mit dem Wunsch nach Bauland auf ihrem Grund.
Die Verwaltungsvorlage folgte diesen Wünschen vollständig. Dabei regelt die BayGO klar: Persönliche Beteiligung liegt vor, wenn ein Beschluss unmittelbare Vorteile oder Nachteile für Ratsmitglieder oder deren Angehörige bringt (Art. 49). Der Stadtrat wurde über diese persönliche Beteiligung nicht informiert. Bürgermeister Kunzmann erklärte, man habe von nichts gewusst – es gebe in Gräfenberg die Auslegung, persönliche Beteiligung entstehe erst beim Bebauungsplan, nicht im Flächennutzungsplan.
Werner Wolf monierte, dass aufgrund des Datenschutzes nicht einmal bekannt sei, wer Stellungnahmen abgebe. VG-Geschäftsführer Kohlmann fand dann aber eine salomonische Lösung: „Wenn Sie von einer Stellungnahme Ihres Angehörigen nichts wissen, können Sie auch nicht in dessen Sinn abstimmen.“
Flächennutzungsplan: Widerstände abgebügelt
84 Bürger-Einwendungen richteten sich gegen die geplante Bebauung der Frischluftschneise zwischen West III und Altenheim sowie gegen das Baugebiet am Michelsberg – in wechselnden Formulierungen. Auch der Bund Naturschutz und die Gemeinde Weißenohe äußerten Bedenken, u. a. wegen Oberflächenwasser. Zur Frischluftschneise: Sie ist seit den 1990ern als Grünzug definiert, wurde in diversen Stadtratsperioden und auch im ISEK festgelegt. Sie sei außerdem wichtig für Klimaanpassung und Stadtklima, sowie als Grünzug zur Erholung. Zum Michelsberg: Kritisiert wurden Biotopverluste, Lärm- und Staubemissionen der Steinbrüche, die Entfernung zur Innenstadt, die weiter ausbluten werde, mangelnde Anbindung an Schulen, die Größe des Baugebiets sowie die Entwässerung.
Planer Bauernschmitt verteidigte das Vorhaben: Im Vergleich zum letzten Flächennutzungsplan sei der Bauflächenanteil deutlich reduziert, Biotope am Michelsberg geschont, das Büro sei unabhängig und habe länger nicht mehr für die Steinbrüche geplant. Zudem: Es bestehe Bedarf, da Eigentümer bestehender Flächen nicht verkaufen wollten. Daher müsse man an den Rand.
Alle Einwände wurden einzeln abgewiesen – stets begleitet von Widerspruch von Matthias Striebich (ausführliche Stellungnahme von ihm hier), in geringerem Maße auch von Martin Leipert und Elisabeth Meinhardt. Diese verwiesen u. a. auf die Entfernung zu Schulen, dem nicht ausgeschöpften Repertoire für Innenentwicklung und dem Ausbluten des Zentrums, das man bereits seit der Errichtung des REWE beobachten könne. Je kompakter der Ort bleibe, desto besser für Fußläufigkeit und ein lebendiges Zentrum. Aus Reihen von CSU und Freien Wählern kam im Laufe der Sitzung wiederholt sinngemäß der Vorwurf, bestimmte Gruppen würden den Mehrheitsbeschluss torpedieren.
Verwiesen wurde dabei in den Beschlussvorlagen stets darauf: man habe ja eine Abwägung getroffen. Welches Gewicht man den einzelnen Belangen in der Abwägung zugestand, war dabei jedoch nicht ersichtlich. Es gab auch im November bereits die Möglichkeit sich mit den Gegenargumenten zum Flächennutzungsplan – sogar in einem Pressebericht – auseinanderzusetzen und sich zu erklären. Bedauerlicherweise drehte sich dieser Pressebericht ausschließlich um bis heute unbelegtes „Eigeninteresse“ grüner Stadträte.
Ein zentrales Argument des Planungsbüros und der Stadtratsmehrheit aus FW und CSU war, man könne Eigentümer von Baulücken und Leerständen nicht zum Verkauf bewegen. Es fehlten schlicht die Instrumente. Stimmt, denn die hat die bayrische Staatsregierung allesamt den Kommunen vorenthalten, im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern. Natürlich gibt es Beispiele, die sogar trotz der bayerischen Staatsregierung enorme Erfolge in der Leerstandsbekämpfung haben (Hofheimer Allianz). Diese betreiben „aktives Management“ – mit Erfolg und ganz ohne Baugebiete am Rand. „Aktives Management“ hatten sich die Freien Wähler zur Wahl 2020 selbst noch auf die Fahnen geschrieben.
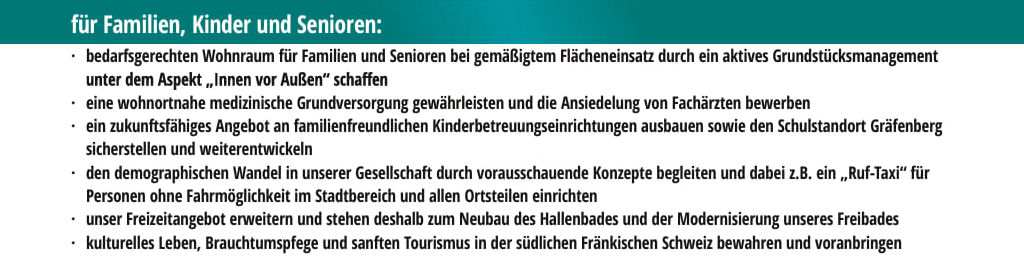
Stellungnahmen der Steinbrüche
Von den „Trägern öffentlicher Belange“ kamen Stellungnahmen der IHK und des Verbands „Baustoffe, Steine, Erden“. Die Forderung: frühzeitig mit Betreibern über Erweiterungen sprechen, Steinbruchflächen aus dem Standortkonzept Photovoltaik entfernen und das Baugebiet Michelsberg aus Immissionsschutzgründen überdenken.
Auch zwei Steinbrüche selbst äußerten sich. Der eine forderte die Löschung alter Biotope und Wege aus seinen Flächen und wandte sich gegen das Freiflächen-Photovoltaikkonzept – das allerdings gar nicht Teil des FNP ist. Der andere sprach sich massiv gegen das Baugebiet Michelsberg aus – vor allem aus Lärmschutzgründen.
Die Beschlussvorlage der Verwaltung verwies auf die Regionalplanung – diese ist zuständig für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, zukünftige Abbauflächen für Kalkgestein.
Neuaufnahmen
In Walkersbrunn, Sollenberg, Lilling und Gräfenberg wurden neue Grundstücke in den Flächennutzungsplan aufgenommen – etwa am Teufelstischweg und ein ehemaliger Steinbruch bei den Schießbergfeldern. Auch ein Grundstück in der Frischluftschneise – gegen die Stimmen von Grünen, SPD und GBL. Mehrere Michelsberg-Flächen wurden hingegen nicht neu aufgenommen. Für alle neuen Flächen folgt ein Auslegungsverfahren, in dem erneute Einwendungen möglich sind.
Damit endete gegen 22:30 die Sitzung. Anfragen gab es keine.

